E1 - Free Flow - 20240413

Mein letzter Beitrag ist für diesen Blog ein Dammbruch. Einfach so aus dem Effeff zu schreiben und zu erzählen, einfach wie es aus mir herauskommt, war in gewisser Weise schon der Plan – also dass ich über die Everydays dazu komme, lockerer und freier zu schreiben. Und mir nicht mehr ständig Gedanken mache: „Passt das?“, „darf man das wirklich so schreiben?“, oder „was ist, wenn das jemandem missfällt?“
Alle meine ersten Beiträge sind mehr oder weniger von diesem selbstkritischen Geist beseelt. Leider kommt man mit einer solchen verunsicherten Haltung – nicht nur im Netz – nicht sonderlich weit. Schlicht schon deshalb, weil man gar nichts fertig schreibt. Es kann ja immer noch besser und noch weiter ausgearbeitet werden.
Diese Lust am immer weiter, genauer und noch dieses Detail kann ich jetzt aber in der Forschung gut gebrauchen. Wenn man dicke Bücher schreiben will, ist das ganz hilfreich. Aber will man Aufsätze schreiben – auch das wäre wichtig für meine Forschung – verhält es sich allerdings etwas anders. Zwar muss man ein Buch irgendwann auch aus der Hand geben und dem Lese-Publikum Gelegenheit geben zu entscheiden, ob es brauchbar, schön, anregend oder aufregend geworden ist. Aber anders als bei einem Aufsatz kann man sich viel länger Zeit lassen. Kurze Texte fühlen sich kurzlebiger an, als wäre es ihnen inhärent, sie viel früher, schnelle aus der Hand geben zu müssen.
Klar alles nur Gefühl und Eindrücke von mir und gewiss, das ist es auch.
Aber ein Gefühl hat sich nach dem letzten Beitrag verflüchtigt, nämlich das Gefühl das mir sagte: „Du musst so schreiben wie ein Republik Journalist!“ Als ob ich mich auf meiner eigenen Webseite wie ein professioneller Essayist anhören müsste. Nicht dass ich es wollte, sondern zu glauben, es zu müssen, ist ja das schlimme.
Jetzt bin ich bereit, mich auf eine Reise zu begeben, meine eigene Stimme zu finden. Wenn nicht auf diesem Blog, wo dann?
Und ich sehe es auf eine andere Weise als meine heilige Pflicht, nämlich als professioneller Theologe meine eigene Stimme zu finden. Wie sollte ich in dieser Welt, ich als Ruben Cadonau, etwas eigenes Sagen über den Einen, über den vermutlich schon alles, alles („Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.“ Koh 1,9) gesagt ist, was gesagt werden kann, sagen?
Nun, ich kann vielleicht nichts Neues sagen, aber ich kann es auf meine eigene, einzigartige Art und Weise sagen (sind wir nicht alle Menschen einzigartig?) und ich glaube, Gott will auch, dass wir gerade genau das tun –als Prediger erst recht –, auf unsere eigenste Weise, von ihm Zeugen und also von ihm zu reden.
Nun, beim professionellen Schreiben habe ich noch einen etwas längeren Weg. Karl Barth zu lesen und dann beim eigenen theologisieren nicht plötzlich wie Karl Barth zu klingen, ist äusserst schwierig. Karl Barth hat – zumindest empfinde ich so – fast alle Bereiche der klassischen Dogmatik derart überzeugend, kreativ, auf seine eigene Weise, mit seiner eigenen Stimme bearbeitet, dass ich schnell vergesse, dass er seine eigene Theologie, sein eigenes Reden selbst auch nur für vorläufig und Fehlerhaft hielt. Ich lerne, mich von meinem Meister, seinem Stil und O-Ton zu emanzipieren; aber kann mir trotzdem nicht verkneifen ihn zu zitieren.
„Diese wird nie eine vollkommene Sache sein können, sondern christliche Dogmatik wird immer ein relatives und ein irrtumsfähiges Denken, Forschen und Darstellen bleiben. Auch Dogmatik kann nach bestem Wissen und Gewissen immer nur fragen nach dem Besseren und sich dessen bewusst bleiben: es kommen nach uns Andere, Spätere, und wer treu ist in diesem Werk, der wird hoffen, dass diese Anderen, Späteren besser und tiefer denken und sagen, was wir zu denken und zu sagen versuchten. Mit ruhiger Nüchternheit und mit nüchterner Ruhe werden wir so unsere Arbeit tun. Wir dürfen unsere Erkenntnis brauchen, so wie sie uns heute geschenkt ist. Es kann von uns nicht mehr gefordert sein als uns gegeben ist. Es kann von uns nicht mehr gefordert sein als uns gegeben ist. Und wie einen Knecht, der über Wenigem treu ist, darf uns dieses Wenige nicht gereuen. Mehr als diese Treue ist von uns nicht verlangt.“ (Barth, Karl: Dogmatik im Grundriß, Zürich 1947, 11-12.)
„‚Wir sind nicht dazu da, um einander zuzustimmen und Beifall zu spenden. Wenn es ‚Barthianer‘ gibt, so gehöre ich selbst nicht zu ihnen. Wir sind dazu da, um voneinander zu lernen, gegenseitig das Beste aus dem zu machen, was wir einander literarisch vorlegen, und um dann – nicht in einer theologischen ‚Schule‘, sondern in der Kirche und also selbständig – unsere Straße zu ziehen. Eben dazu muß man einander aber verstehen.‘“ (Ein Zitat Karl Barths aus: Busch, Eberhard: Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, München 1975, 390.)
Kein Barthianer zu sein, sondern ganz schlicht ein Christ, das hat aus einem mir unbekannten Grund für mich eine Schönheit, die mir den Atem raubt. Wir sind alle – mögen wir einander noch so bewundern –, wir sind alle gleich vor unserem Herrn. Und wir sind alle, ihm verantwortlich. Und nicht einer imaginären Idealvorstellung oder Erwartung, die wir anderen über uns zu haben unterstellen. Und das ist es ja oft. Ich unterstelle euch – mich jetzt und hier zu verurteilen. Weil dieser Text nicht das besondere Etwas hat, nicht vollkommen ausgereift ist, wie ein tausendjähriger Wein in Fässern aus Mahagoni (vermutlich ist das geschmacklich auch nichts, sorry an alle Önologen für meinen Dilettantismus). Es reicht einfach mein Bestes zu geben, nicht Karl Barths Bestes.
Eigentlich eine offensichtliche Einsicht. Aber gerade die offensichtlichsten Einsichten, sind nicht selten diejenigen, die am schwersten umzusetzen sind.
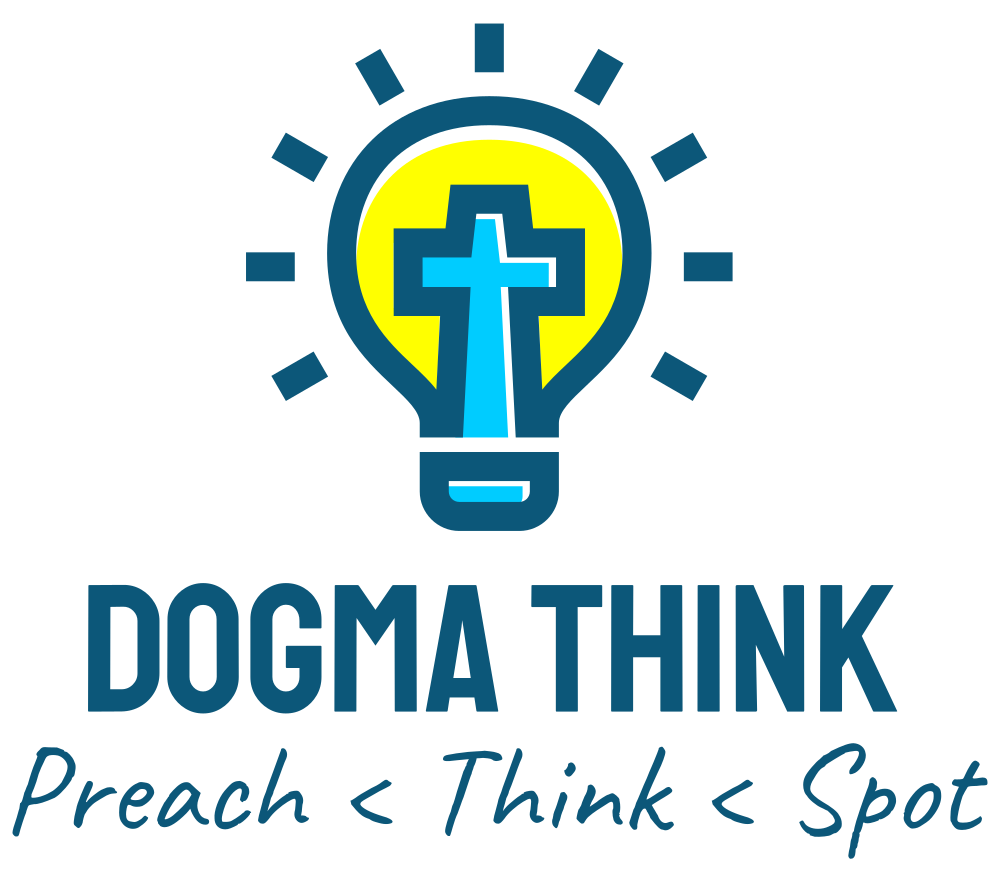
Member discussion